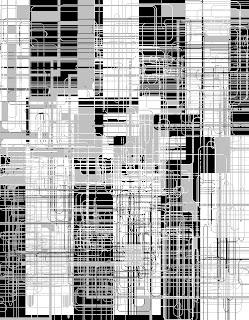Es wird ja allgemein behauptet, dass die Major-Firmen die Independent-Bands heutzutage ignorieren würden, dass all die gute, handgemachte Musik marginalisiert wäre und in der Öffentlichkeit nur noch Meanstream zu hören sei. Aber früher, ja damals in den guten Tagen, da wäre alles völlig anders gewesen.
Das war es nicht. Nur sind die Schallplatten der Independent-Gruppen in den letzten Jahren und Jahrzehnten leider im Orkus verschwunden (der steht im dritten Keller des Universal-Headquarters, umzüngelt von Flammen und Schwefeldunst verströmend)
Es gab da eine Band in Kananda mit dem Namen Perth County Conspiracy. Das war eine Hippie-Kommune, die auch zusammen Musik machte. Vertrackte Kompositionen mit politischen Texten über Richard Nixon und die CIA.
Deshalb wurden sie 1975 auch zum "5. Festival des politischen Liedes" in die Hauptstadt der DDR eingeladen, und nahmen dort eine Schallplatte für AMIGA auf. (Die Wege der Hippies zogen im Kalten Krieg manchmal merkwürdige Schleifen).
Und zwanzig Jahre später kaufte ich diese LP auf dem Plattenbasar der Amerika-Gedenk-Bibliothek und fand sie großartig.
Heute habe ich wieder mal im Netz geschaut, ob ich etwas Neues über sie finde. Und ich fand, und wurde von dort zu dem Youtube-Konto eines Italieners verlinkt, wo ich sie alle entdeckte: die Vergessenen, die Ignorierten, die verhinderten Stars. Hier eine klitzekleine Auswahl:
.
Samstag, 28. April 2012
Es ist alles immer kleiner geworden. In den frühen Neunzigern war meine ganze Wohnung mein Atelier, mein Studio. Dreckig, verqualmt und angefüllt mit Versuchen. Später ein Zimmer mit zwei Schreibtischen und einer Staffelei. Dann nur noch mein Zimmer mit einem Arbeitsplatz am Fenster (diese Blüten der Bäume im Frühjahr, vor der neusachlichen Mietskaserne vis á vis). Schließlich eine Kammer hinter der Küche, jetzt, in der Jetztzeit, knapp vier Quadratmeter groß, voll von Entwürfen und expressionistischen Perspektiven. Mit einem Fenster zum Hof, mehr eine Schießscharte. Mit einem Sekretär aus den 60ern. Mit Gottfried Benn im Rücken. Mit Spinnen in den Winkeln (im Sommer), und mit Heizlüfter gegen die Kälte (im Winter).
Meine Kammer zeugt von Armut. Und meine Armut kotzt mich an. Aber so viele Manuskripte pochen in der Kammer, und auf dem Bildschirm des Laptops (aus den Neunzigern) sind Bilder gespeichert.
Und die Bilder halten mich vom Schreiben ab, so wie sie es schon früher getan haben, und auch sie bringen kein Geld ein, ermöglichen mir kein Studio von fünfzig Quadratmetern, das zwei Straßen weiter wartet, jeden Abend auf mich (wie eine spröde Geliebte).
Jetzt stehe ich wieder an diesem Punkt, der ausschaut wie ein Start, der aber vielmehr der Anfang einer Spirale ist.
Vor fünfzehn Jahren malte ich noch während ich schrieb. Oder besser gesagt: ich malte immer dann, wenn ich mit dem Schreiben nicht weiter kam. Und wenn ich nicht mehr malen konnte, schrieb ich. Es war eine Qual, die ich nicht erkannte. Die eine Kunst stand der anderen im Weg; wenn ich nicht in einer den Durchbruch schaffte, dann vielleicht in der anderen. Und also stand ich da und schaute auf die Werke. Und die Werke waren nicht gut, denn es war mir immer möglich, mich aus dem einen Schaffen herauszuwinden, um in das andere Schaffen einzutauchen. Der Effekt: Mittelmaß. Deshalb gab ich mit dreißig Jahren das Malen auf. Und jetzt habe ich mit dem Malen wieder begonnen, und stehe mir selbst im Weg rum. Ich hätte den Abend am Roman schreiben sollen (aber der Geist Hemingways war nicht in der Kammer und hat mir nicht auf das Maul gehauen). Stattdessen habe ich Bilder konstruiert. Und hier sind sie, sieben graue Bilder. Und meine Kammer. Und ich.
.
Donnerstag, 26. April 2012
Heute ist der Jahrestag. Vor 26 Jahren platzte der Reaktor in Wermut (russ.: Tschernobyl). Und die ersten Nachrichten über den Super-GAU wurden in der ARD an meinem sechzehnten Geburtstag vermeldet - es bestand natürlich keine Gefahr für die Bevölkerung, wie uns der Herr Innenminister Zimmermann versicherte. Merkwürdig nur, dass es in Süddeutschland kurz darauf keinen Salat mehr zu kaufen gab, und auch die Pilzsaision würde ins (leicht radioaktive) Regenwasser fallen. Wildschweine und Rehe wurden fortan alt und fett. Und zuvor waren in Karlsruhe schon die Kinderspielplätze gesperrt, und der Sand wurde einige Wochen später ausgetauscht.
Vier Jahre zuvor hatte ich zum ersten Mal diese Abkürzung gehört: GAU. Im Erdkundeunterricht wurde der Nutzen der Atomkraft durchgenommen, und der Herr Lehrer versicherte, dass natürlich keine Gefahr für die Bevölkerung entstehen könne, eine GAU nur in der Theorie möglich sei.
Als ich nachfragte, renitenter Zwölfjähriger der ich war, beharrte er auf seinen Vorgaben. Und ich beharrte darauf, dass es mir nicht einleuchten würde, dass ein GAU nicht passieren könne.
Ich hatte viele unfähige Lehrer in meiner Jugend, nicht nur dieser erste Erdkundelehrer war völlig vernagelt, auch eine spätere Lehrerin des Fachs machte sich lächerlich, als sie vor der versammelten Klasse behauptete, die Antarktis sei eine Ansammlung von kleineren Inseln, auf dem nur der Eisschild über dem Meeresspiegel ruhen würde. Als ich widersprach und vorschlug, doch einmal im Atlas nachzuschauen, denn da sei sicher ein Querschnitt des Kontinents abgebildet, eines Kontinents, der auch eisfrei noch immer größer als Australien sei, da putzte sie mich runter und ließ, sie war sich ihrer fachlichen Kompetenz so sicher, den Atlas aufschlagen. Und in dem schönen, dunkelblauen Diercke-Schulatlas war er natürlich, der Querschnitt, und er zeigte, dass es sich nicht um Inseln sondern um Gebirge eines Kontinents handelte, und das schon eine sehr große Welle hätte kommen müssen, um über die Berge hinweg die zentrale Tiefebene zu überfluten (wenn man einmal annahm, der Eisschild sei nicht vorhanden). Ich hatte also Recht behalten und wurde zur Strafe vor die Tür geschickt.
Die gute Frau Duelli, ich habe sie in Erinnerung behalten. Genauso wie meinen Deutschlehrer Herrn Albertini, der mir eine Vier gab in der Zeit, in der ich zu Hause schon Theaterstücke schrieb. Ein Pädagoge sondergleichen. (Den einzigen wirklich guten Lehrer, dem ich auf all meinen Oberschulen begegnete, war der Geschichtslehrer Herr Schumacher; der war gut, der hat mir was beigebracht).
Ich hoffe, die zukünftigen Lehrer meines Sohnes werden nicht ganz so schlecht sein, und ihm meine schulische Karriere ersparen, die in absteigender Linie Gymnasium, Real- und Hauptschule umfasste.
.
Vier Jahre zuvor hatte ich zum ersten Mal diese Abkürzung gehört: GAU. Im Erdkundeunterricht wurde der Nutzen der Atomkraft durchgenommen, und der Herr Lehrer versicherte, dass natürlich keine Gefahr für die Bevölkerung entstehen könne, eine GAU nur in der Theorie möglich sei.
Als ich nachfragte, renitenter Zwölfjähriger der ich war, beharrte er auf seinen Vorgaben. Und ich beharrte darauf, dass es mir nicht einleuchten würde, dass ein GAU nicht passieren könne.
Ich hatte viele unfähige Lehrer in meiner Jugend, nicht nur dieser erste Erdkundelehrer war völlig vernagelt, auch eine spätere Lehrerin des Fachs machte sich lächerlich, als sie vor der versammelten Klasse behauptete, die Antarktis sei eine Ansammlung von kleineren Inseln, auf dem nur der Eisschild über dem Meeresspiegel ruhen würde. Als ich widersprach und vorschlug, doch einmal im Atlas nachzuschauen, denn da sei sicher ein Querschnitt des Kontinents abgebildet, eines Kontinents, der auch eisfrei noch immer größer als Australien sei, da putzte sie mich runter und ließ, sie war sich ihrer fachlichen Kompetenz so sicher, den Atlas aufschlagen. Und in dem schönen, dunkelblauen Diercke-Schulatlas war er natürlich, der Querschnitt, und er zeigte, dass es sich nicht um Inseln sondern um Gebirge eines Kontinents handelte, und das schon eine sehr große Welle hätte kommen müssen, um über die Berge hinweg die zentrale Tiefebene zu überfluten (wenn man einmal annahm, der Eisschild sei nicht vorhanden). Ich hatte also Recht behalten und wurde zur Strafe vor die Tür geschickt.
Die gute Frau Duelli, ich habe sie in Erinnerung behalten. Genauso wie meinen Deutschlehrer Herrn Albertini, der mir eine Vier gab in der Zeit, in der ich zu Hause schon Theaterstücke schrieb. Ein Pädagoge sondergleichen. (Den einzigen wirklich guten Lehrer, dem ich auf all meinen Oberschulen begegnete, war der Geschichtslehrer Herr Schumacher; der war gut, der hat mir was beigebracht).
Ich hoffe, die zukünftigen Lehrer meines Sohnes werden nicht ganz so schlecht sein, und ihm meine schulische Karriere ersparen, die in absteigender Linie Gymnasium, Real- und Hauptschule umfasste.
 |
| Die Antarktis eisfrei (Karte von Cristellaria) |
.
Mittwoch, 25. April 2012
Endlich Frühling. Endlich wieder atmen im Grünen. (Leider auch mit leichtem Heuschnupfen). Morgen soll das Thermometer über zwanzig Grad anzeigen, und am Wochenende, zu meinem Geburtstag, dann der Sommer - der offenbar dem langgezogenen Winter folgen mag.
Gestern habe ich mir in der Bibliothek die Fernsehserie "Holocaust" ausgeliehen und heute Morgen gleich die erste Folge in das Laufwerk des Notebooks gelegt.
Ich kann mich gut erinnern, wie ich mit neun Jahren die Serie zum ersten Mal sah. Ganz (West)-Deutschland hockte vor den Empfangsgeräten und beschäftigte sich zum aller ersten Mal mit Schuld. Mit der eigenen nämlich. Und auch meine Eltern schauten zu und ließen uns Kinder teilhaben, mitschauen. Es war, glaube ich, meine erste Erfahrung mit einem Erwachsenenthema, und ich erinnere mich, dass meine Eltern zuvor lange diskutiert hatten, ob ich für diese Filme noch zu klein wäre. Ich war es nicht, und natürlich beeindruckt, und verstört, und nachdenklich.
Kaum etwas aus dem Erwachsenen-Fernsehprogramm ist mir so nachhaltig in Erinnerung geblieben, außer vielleicht noch die Serie "Der Eiserne Gustav", die zum Teil ja auch in der Nazi-Zeit spielte. (Legendär die Szene, als dem schönen Eugen das Gesicht mit Leuchtspurmunition verbrannt wird - Gott, was habe ich mich damals gegruselt; demletzt wieder, als ich die Serie nochmals sah).
Auch "Holocaust" wirkt als Film wenig angestaubt, doch natürlich ein wenig kulissenhaft und durchkonstruiert. Aber das ist bei dem Thema kaum zu vermeiden. Die Frage war ja schon immer, und ist sie noch, ob man das Grauen von Auschwitz darstellen kann? (Und der Halbsatz "Das Grauen von Auschwitz" wirkt in einem Blog auch schon abgeschmackt und fehl am Platz - die Annäherung an die Shoah, sei es künstlerisch oder berichtend bleibt nahezu unmöglich, jedenfalls für die Nachgeborenen. Das einzige Werk zu diesem Themenkomplex, das mich völlig überzeugt und völlig mitgenommen hat (in des doppelten Sinne), war "Nacht" von Edgar Hilsenrath).
Jedenfalls ist die Serie - ins Besondere für eine Hollywoodproduktion - erstaunlich differenziert und historisch informiert. Und ich fiebere natürlich für die Familie Weiss, heutzutage vor allem für den Vater... bald werde ich zweiundvierzig.
Ich war vier Jahre alt, als wir den ersten Fernseher bekamen, zur Fussballweltmeisterschaft; mein Vater hatte darauf bestanden. Die erste Röhre, schwarzweiß natürlich, und der Empfang war größtenteils unterdurchschnittlich, um es vorsichtig zu sagen: ständig rauschte dichter Schnee über den Bildschirm, jede Fernsehansagerin (Hanni Vanhaiden!) zog ein Geisterbild hinter sich her, aber endlich konnte ich auch die Rappelkiste sehen, und das Feuerrote Spielmobil, den Schülerladen. Dies alles Sendungen, die mittelbar und in Reaktion auf die Nazi-Zeit entstanden waren, als antiautoritäres Antidot zum Faschismus. Was mir als Kind natürlich wurscht war, ich wollte Pan Tau sehen und die tschechischen Knetmännchen. Den Maulwurf Grabowski (wobei, der kam in der Sesamstraße) - der Ostblock hatte sowieso in allen Kinderherzen gesiegt, denn von dort kamen die besten Trickfilme (und mehr und mehr auch aus Japan).
Heute habe ich keinen Fernseher mehr, kurz vor der Geburt unseres Sohnes haben wir ihn verschenkt. Nur ab und an möchte ich eine Erfahrung wiederholen und leihe eine DVD aus. Leider gibt es da keine Fernsehansagerinnen mehr. Und keine Diskussionsrunden im Anschluss, in einem Studio mit schwarzem Hintergrund, vor dem sich der Zigarettennebel besonders gut abhebt, denn alle, alle in der Runde rauchten eine nach der anderen. Auch das natürlich ein mittelbar antifaschistisches Element (Wir erinnern uns "Der Führer" war Nichtraucher und sehr besorgt um die deutsche Volksgesundheit). Ich will die Leute im Fernseher wieder rauchen sehen. Meinetwegen E-Zigaretten.
.
Gestern habe ich mir in der Bibliothek die Fernsehserie "Holocaust" ausgeliehen und heute Morgen gleich die erste Folge in das Laufwerk des Notebooks gelegt.
Ich kann mich gut erinnern, wie ich mit neun Jahren die Serie zum ersten Mal sah. Ganz (West)-Deutschland hockte vor den Empfangsgeräten und beschäftigte sich zum aller ersten Mal mit Schuld. Mit der eigenen nämlich. Und auch meine Eltern schauten zu und ließen uns Kinder teilhaben, mitschauen. Es war, glaube ich, meine erste Erfahrung mit einem Erwachsenenthema, und ich erinnere mich, dass meine Eltern zuvor lange diskutiert hatten, ob ich für diese Filme noch zu klein wäre. Ich war es nicht, und natürlich beeindruckt, und verstört, und nachdenklich.
Kaum etwas aus dem Erwachsenen-Fernsehprogramm ist mir so nachhaltig in Erinnerung geblieben, außer vielleicht noch die Serie "Der Eiserne Gustav", die zum Teil ja auch in der Nazi-Zeit spielte. (Legendär die Szene, als dem schönen Eugen das Gesicht mit Leuchtspurmunition verbrannt wird - Gott, was habe ich mich damals gegruselt; demletzt wieder, als ich die Serie nochmals sah).
Auch "Holocaust" wirkt als Film wenig angestaubt, doch natürlich ein wenig kulissenhaft und durchkonstruiert. Aber das ist bei dem Thema kaum zu vermeiden. Die Frage war ja schon immer, und ist sie noch, ob man das Grauen von Auschwitz darstellen kann? (Und der Halbsatz "Das Grauen von Auschwitz" wirkt in einem Blog auch schon abgeschmackt und fehl am Platz - die Annäherung an die Shoah, sei es künstlerisch oder berichtend bleibt nahezu unmöglich, jedenfalls für die Nachgeborenen. Das einzige Werk zu diesem Themenkomplex, das mich völlig überzeugt und völlig mitgenommen hat (in des doppelten Sinne), war "Nacht" von Edgar Hilsenrath).
Jedenfalls ist die Serie - ins Besondere für eine Hollywoodproduktion - erstaunlich differenziert und historisch informiert. Und ich fiebere natürlich für die Familie Weiss, heutzutage vor allem für den Vater... bald werde ich zweiundvierzig.
Ich war vier Jahre alt, als wir den ersten Fernseher bekamen, zur Fussballweltmeisterschaft; mein Vater hatte darauf bestanden. Die erste Röhre, schwarzweiß natürlich, und der Empfang war größtenteils unterdurchschnittlich, um es vorsichtig zu sagen: ständig rauschte dichter Schnee über den Bildschirm, jede Fernsehansagerin (Hanni Vanhaiden!) zog ein Geisterbild hinter sich her, aber endlich konnte ich auch die Rappelkiste sehen, und das Feuerrote Spielmobil, den Schülerladen. Dies alles Sendungen, die mittelbar und in Reaktion auf die Nazi-Zeit entstanden waren, als antiautoritäres Antidot zum Faschismus. Was mir als Kind natürlich wurscht war, ich wollte Pan Tau sehen und die tschechischen Knetmännchen. Den Maulwurf Grabowski (wobei, der kam in der Sesamstraße) - der Ostblock hatte sowieso in allen Kinderherzen gesiegt, denn von dort kamen die besten Trickfilme (und mehr und mehr auch aus Japan).
Heute habe ich keinen Fernseher mehr, kurz vor der Geburt unseres Sohnes haben wir ihn verschenkt. Nur ab und an möchte ich eine Erfahrung wiederholen und leihe eine DVD aus. Leider gibt es da keine Fernsehansagerinnen mehr. Und keine Diskussionsrunden im Anschluss, in einem Studio mit schwarzem Hintergrund, vor dem sich der Zigarettennebel besonders gut abhebt, denn alle, alle in der Runde rauchten eine nach der anderen. Auch das natürlich ein mittelbar antifaschistisches Element (Wir erinnern uns "Der Führer" war Nichtraucher und sehr besorgt um die deutsche Volksgesundheit). Ich will die Leute im Fernseher wieder rauchen sehen. Meinetwegen E-Zigaretten.
 |
| Im Hintergrund das erste Fernsehgerät |
.
Sonntag, 22. April 2012
Ich höre gerade Peace dragon, das letzte Album der Beatles, das, nach einer Phase der Agonie, im Jahre 1973 auf den Markt geworfen und über zwanzig Millionen Mal weltweit verkauft wurde.
Nachdem sich Lennon und McCartney 1970 – nach einer kreativen Pause – zusammen gerauft hatten (denn ihre Soloalben waren gefloppt) hatten sie zusammen mit George und Ringo ihr bis dato schlechtestes Album veröffentlicht (Going Home, ein müder Aufguss ihrer frühen Erfolge, angefüllt mit zweitklassigen Rock´n´Roll-Songs). Im Frühjahr 1971 trennte sich dann George Harrison von der Gruppe um, wie er sagte, etwas Ruhe in einem Ashram zu finden, und wurde durch Sterling Morrison ersetzt, der vormals bei The Velvet Underground gespielt hatte. Lennon hatte Morrison einige Monate zuvor bei einer Vernisage Andy Warhols in New York City kennen gelernt.
Durch die neue Leadgitarre war der Sound der Beatles düsterer geworden, Peace dragon näherte sich dem an, was man heute als Protopunk oder Proto-New-Wave bezeichnen würde. Lennon verarbeitete in einigen explodierenden Klangcollagen die ambivalente Beziehung zu seiner Mutter, und Sterling Morrison untermalte diese Urschrei-Erfahrung mit einem sägenden, dröhnenden Gitarrensound.
Die Kritiker waren überrascht, das Publikum war es auch, und obwohl sich nur Paul McCartneys Coverversion von Woody Guthries This land is your land in den Charts platzieren konnte, verkaufte sich das Album über die Jahre so gut, dass auch der Rolling Stone es 1983 zu den Hundert wichtigsten LPs der 70er zählte.
Ins Besondere die Lennon/Morrison-Komposition War is in my head wurde in den 80ern oft gecovert, und 1984 landeten Joy Division mit diesem Song ihren größten Hit, was sicherlich an der grandiosen Interpretationskraft Ian Curtis lag.
Doch 1974 zog sich John Lennon aus dem Musikgeschäft zurück - aus seinem Umkreis wurde berichtet, er sei ausgebrannt - und kaufte zusammen mit seiner zweiten Frau Yoko Ono eine Farm in Nevada, wo er nurmehr Gedichte schrieb, die zwar regelmäßig veröffentlicht wurden, sich aber nicht gut verkauften.
1978 dann gab er zusammen mit Paul, George und Ringo ein Reunion-Konzert im Madison Square Garden, an dem auch Sterling Morrison als zweiter Leadgitarrist teilnahm, und bei dem Lou Reed einen Gastauftritt mit Tomorrow never knows hatte.
Auf einer Photographie können wir David Bowie und Iggy Pop im Publikum sehen, die anlässlich des Konzerts extra von Berlin-Schöneberg angereist waren.
1979 gab Lennon bei Stiff Records sein zweites Soloalbum heraus, eine Homage an Brecht/Weill, auf dem auch ein Ausschnitt der Dreigroschenoper zu hören war. Yoko sang die Seeräuberbraut. Danach zog er sich erneut auf seine Farm in Nevada zurück. Dort starb er 1982 an der Kugel eines Attentäters, der so perfide war, sich als bedürftiger Gast aufnehmen zu lassen, und dessen Namen hier nicht genannt werden soll.
Träume. So große Träume. (Seinen ersten Roman publizierte Lennon 1989; die berührende Geschichte der Ehe seiner Tante Mimi). Träume. Es träumte mir eine andere Welt.
Natürlich höre ich nicht Peace dragon sondern Beatles for sale und Revolver. Bald ist es fünfzig Jahre her, das die Band ihre erste Single rausgebracht hat. Ein halbes Jahrhundert; das macht die Sache noch historischer, als sie es ohnehin die letzten Jahre (seit der Wende) war. Aus längst vergangenen Jugendtagen... aber, halt, da war ich noch nicht einmal geboren. So lange ist das schon her, so lange. Aber der Sound der Konserve: tiptop (dank George Martin).
Ein merkwürdiges Phänomen, dass ich mich wieder so intensiv mit den Beatles beschäftige, ich lese sogar eine neue Biographie über Lennon (von Thomas Göthel – gar nicht mal schlecht), ich höre die alten Platten, die ich mir in den letzten Wochen aus der Bibliothek ausgeliehen und gebrannt habe, denn die Vinylscheiben aus meiner Kindheit und Jugend sind nicht mehr das Wahre. Ich habe mit ihnen – ich erwähnte das schon – zu viel gescratcht in den frühen 80er Jahren.
Ich kann mich erinnern, wie ich zum ersten Mal eigenständig eine Platte auf die elterliche Stereoanlage legte (die teuer bezahlt war mit einer Monatsgage). War es Django Reinhardt? Das Lied mit der Singenden Säge, das ich so liebte, als ich sechs Jahre alt war, oder war es Revolver, auf der ich Taxman immer wieder hören wollte; diese keifende E-Gitarre? Und die Möwen auf Tomorrow never knows, ich liebte sie, als ich ein Kind war (liebe sie noch heute, habe demletzt alle Loops auf youtube gehört, alle Loops befreit von der Musik; diese Geisterklänge, die nackt in der Tonspur standen).
Und ich habe mich selbst gehört.
Tapes meiner ersten Bands, aufgenommen in mit Holz verschalten Proberäumen im Zeitraum 1986 bis 1990. Geisterhafter noch als die Möwen, ist meine Stimme. Ein dünner Junge in der Provinz, der viel vor hat, der viel sein will. Mit einer gar nicht so üblen Stimme. Und mit Zorn. Und mit Melancholie.
All diese Cassetten muss nun ich digitalisieren mit dem merkwürdigen, walkman-artigen Gerät einer Feundin (danke, Barbara). All diese Bänder soll ich digitalisieren? So viel Vergangenheit! Und alles auf den guten BASF-Bändern, die auch nach einem Viertel Jahrhundert keine Drop-outs haben. Die BASF-Cassetten mit den hellbraunen Hüllen. Die kosteten seinerzeit fünf oder sechs Mark pro Stück, das Taschengeld einer ganzen Woche.
Immerhin habe ich investiert, habe keinen Mist für zwei Mark gekauft, kann jetzt die rührenden Versuche, ein Rebell zu sein in der Stereoanlage meines Vaters hören, die letzte Stereoanlage, die er besessen, und die ich ihm gekauft hatte, bei Neckermann, fünf Jahre vor seinem Tod.
.
Samstag, 21. April 2012
Bach, Werke für Laute, auf nur einer Laute von Walter Gerwig 1964 eingespielt, was unfassbar ist, denn es hört sich teils wie zwei Instrumente an. Gerwig ist ein bis heute unerreichter, und leider fast vergessener Musiker - und ich habe viele Lautenisten gehört - ein Genie sowohl der Technik als auch der Inspiration. Immer wieder ist es für mich beglückend ihn zu hören. Nur gut, dass es Tonkonserven gibt, ich wäre sonst nie in den Genuss gekommen, denn Walter Gerwig starb bereits 1966 mit Mitte Sechzig.
Mein größter Traum wäre ja die Erfindung des Phonographen fünfzig Jahre früher, als sie dann leider erst stattgefunden hatte. Wir könnten nicht nur Schumann hören, wie er seinen Kindern die Waldscenen vorspielt (sein Kopf nickt leicht dabei), wir könnten auch den alt- und stocktaub gewordenen Beethoven beim Improvisieren lauschen (neben sich, auf einem Schemel, die Rotweinflasche). Und, ich darf nicht dran denken, wir könnten akustisch dabei sein, wenn der traurige Schubert allein an seinem Fortepiano sitzt - nicht im Kreise seiner Freunde, nein, allein in seinem Zimmer, eine Lampe auf dem Tisch am Fenster, hinter den schlierigen Fensterscheiben wirbelt der Schnee) - und er spielt nicht nur, er singt auch noch: Die Winterreise... Eine Krähe war mit mir aus der Stadt gezogen.
Die Stimme Goethes: eine Mischung aus hessischem und thüring´schem Näseln. Hölderlins autistisch vernuscheltes Schwäbisch. Heinrich Heines sanfmütiges Rheinisch. Merkwürdige Vorstellungen.
Immerhin habe wir ein annäherndes Beispiel von Beethovens Improvisationskunst: der Klavierteil der Chorfantasie c-moll op. 80 wurde bei der Uraufführung vom Maestro selbst, ja, phantasiert, und nach der Premiere dann in Noten gesetzt. Offenbar ohne größere Überarbeitungen. Mit Opus 80 haben wir sozusagen einen Live-Mitschnitt.
Und Robert Schumann hätte ja fast das Alter für die erste Aufnahme erreicht, hätte er sich nicht die Leber weg gesoffen; im April 1860, siebzehn Jahre vor Edisons erster Phonograph-Aufnahme, wurde eine unbekannte Frauenstimme festgehalten, auf dem obskuren Phonautograph des Franzosen Edouard-Leon Scott de Martinville. Etwas über eine Minute lang erklingt, nein, erkrächzt das Kinderlied "Au clair de la lune". Eine Stimme die nun genau 152 Jahre alt ist. Hier zu hören: Link
.
Mein größter Traum wäre ja die Erfindung des Phonographen fünfzig Jahre früher, als sie dann leider erst stattgefunden hatte. Wir könnten nicht nur Schumann hören, wie er seinen Kindern die Waldscenen vorspielt (sein Kopf nickt leicht dabei), wir könnten auch den alt- und stocktaub gewordenen Beethoven beim Improvisieren lauschen (neben sich, auf einem Schemel, die Rotweinflasche). Und, ich darf nicht dran denken, wir könnten akustisch dabei sein, wenn der traurige Schubert allein an seinem Fortepiano sitzt - nicht im Kreise seiner Freunde, nein, allein in seinem Zimmer, eine Lampe auf dem Tisch am Fenster, hinter den schlierigen Fensterscheiben wirbelt der Schnee) - und er spielt nicht nur, er singt auch noch: Die Winterreise... Eine Krähe war mit mir aus der Stadt gezogen.
Die Stimme Goethes: eine Mischung aus hessischem und thüring´schem Näseln. Hölderlins autistisch vernuscheltes Schwäbisch. Heinrich Heines sanfmütiges Rheinisch. Merkwürdige Vorstellungen.
Immerhin habe wir ein annäherndes Beispiel von Beethovens Improvisationskunst: der Klavierteil der Chorfantasie c-moll op. 80 wurde bei der Uraufführung vom Maestro selbst, ja, phantasiert, und nach der Premiere dann in Noten gesetzt. Offenbar ohne größere Überarbeitungen. Mit Opus 80 haben wir sozusagen einen Live-Mitschnitt.
Und Robert Schumann hätte ja fast das Alter für die erste Aufnahme erreicht, hätte er sich nicht die Leber weg gesoffen; im April 1860, siebzehn Jahre vor Edisons erster Phonograph-Aufnahme, wurde eine unbekannte Frauenstimme festgehalten, auf dem obskuren Phonautograph des Franzosen Edouard-Leon Scott de Martinville. Etwas über eine Minute lang erklingt, nein, erkrächzt das Kinderlied "Au clair de la lune". Eine Stimme die nun genau 152 Jahre alt ist. Hier zu hören: Link
.
Freitag, 20. April 2012
Auf allen Blogs und Facebookstreams kocht eine Diskussion über die Verleihung des Ringelnatz-Preises an Nora Gomringer hoch, und ob das Hinterherwerfen von Preisen in nicht abbrechender Folge eine gerechte Sache sei, oder ob es vielmehr ein deutliches Licht auf die Literatur-Juroren des Landes wirft, und ob dieses Licht eine kleine und dunkle Ecke ausleuchtet, in der ein verleugnetes Mini-Monster namens Feigheit zittert. Feigheit? Ja, die Feigheit keine eigenen Entscheidungen zu treffen, stattdessen nur die DichterInnen zu prämieren, die bereits von unzähligen Jury- und Institutions-Mitgliedern für prämierbar gehalten wurden. Ein altbekanntes Phänomen, das sicher nicht an die Slammerin Gomringer gebunden ist.
Ich persönlich gönne ihr jeden Preis, sie kann ja nichts für die Verunsicherung einzelner Juroren, doch diesen einen Preis, eben den nach Ringelnatz benannten, hat sie meiner Meinung nach zu Unrecht erhalten, weil das Gedicht, das von der Jury besonders hervor gehoben wurde ("Und es war ein Tag"), eine ziemlich deutliche Entgleisung ist. Der Text thematisiert eine Fahrt im Viehwaggon, eine Fahrt die in Auschwitz enden wird (und das ist unguterweise auch noch die Schluss"pointe" des Gedichts, das gedehnt gelesene Wort "Auschwitz"). Und diese Fahrt wird beschrieben mit einem geradezu ranschmeißerischen Gestus, den ich nur als den Gestus der Autorin verstehen kann. Als würde sie über der Szene schweben und berichten, Zeugnis ablegen. Das ganze auch noch in einem leicht alttestamentarischen, raunenden Ton, der mir die Galle hat hochkommen lassen.
Und ich scheine nicht der Einzige gewesen zu sein, denn auf allen Kanälen (auch auf denen im Hintergrund der E-mail-Postfächer) wird seitdem getippt und disputiert. (Am Intensivsten in der Kommentarebene der Lyrikzeitung.com).
Allerdings nicht unter Beteiligung Anton G. Leitners, der sich aber offenbar dort ein bisschen Gewürzbrühe für sein eigenes Süppchen gesogen, und der fix seine Vorschläge in der Presse (unter anderem im Züricher Tagesanzeiger und im Berliner Tagesspiegel) lanciert hat, unter Berufung auf die Literaturszene.
Besonders schäbig ist, dass er Lyriker nennt, die er nicht für preiswürdig hält, weil sie ihm zu wenig durchschaubar und zu sehr akademisch schreiben. Das kommt dem einfachen Herrn Leitner unter anderem bei Ron Winkler so vor, der zum einen fern des akademischen Schreibens, und der zum anderen - meinem Eindruck nach - eine der maßgeblichen Stimmen unserer Generation ist. Desweiteren versteht Herr Leitner Ulrike Sandig und Daniela Seel nicht. Und schlägt implizit vor, solchen DichterInnen keine Preise mehr zu verleihen. Das alles, wie gesagt, unter Berufung auf die Literaturszene.
Ich sage es deutlich: auf mich darf Leitner sich nicht beziehen, ich stimme ihm nicht zu, in keinem Punkt (ausser in eben dem einen, dass die Jurys in Deutschland ihre Preise immer in die gleiche Richtung werfen). Und ich will unter keinen Umständen, so wie von Leitner vorgeschlagen, dass Lyrikpreise an Herausgeber, Lyrikvermittler und Lyrikveranstalter vergeben werden.
Dann schon lieber alle, alle an Nora Gomringer.
Zur Preisverleihung an Nora Gomringer: Link
Zu (u.a.) Anton G. Leitners Einlassungen: Link
Diskussion zur Preisverleihung: Link
Diskussion zur Leitners Einlassungen Link
Das Gedicht "Und es war ein Tag", gelesen von der Autorin: Link
.
Ich persönlich gönne ihr jeden Preis, sie kann ja nichts für die Verunsicherung einzelner Juroren, doch diesen einen Preis, eben den nach Ringelnatz benannten, hat sie meiner Meinung nach zu Unrecht erhalten, weil das Gedicht, das von der Jury besonders hervor gehoben wurde ("Und es war ein Tag"), eine ziemlich deutliche Entgleisung ist. Der Text thematisiert eine Fahrt im Viehwaggon, eine Fahrt die in Auschwitz enden wird (und das ist unguterweise auch noch die Schluss"pointe" des Gedichts, das gedehnt gelesene Wort "Auschwitz"). Und diese Fahrt wird beschrieben mit einem geradezu ranschmeißerischen Gestus, den ich nur als den Gestus der Autorin verstehen kann. Als würde sie über der Szene schweben und berichten, Zeugnis ablegen. Das ganze auch noch in einem leicht alttestamentarischen, raunenden Ton, der mir die Galle hat hochkommen lassen.
Und ich scheine nicht der Einzige gewesen zu sein, denn auf allen Kanälen (auch auf denen im Hintergrund der E-mail-Postfächer) wird seitdem getippt und disputiert. (Am Intensivsten in der Kommentarebene der Lyrikzeitung.com).
Allerdings nicht unter Beteiligung Anton G. Leitners, der sich aber offenbar dort ein bisschen Gewürzbrühe für sein eigenes Süppchen gesogen, und der fix seine Vorschläge in der Presse (unter anderem im Züricher Tagesanzeiger und im Berliner Tagesspiegel) lanciert hat, unter Berufung auf die Literaturszene.
Besonders schäbig ist, dass er Lyriker nennt, die er nicht für preiswürdig hält, weil sie ihm zu wenig durchschaubar und zu sehr akademisch schreiben. Das kommt dem einfachen Herrn Leitner unter anderem bei Ron Winkler so vor, der zum einen fern des akademischen Schreibens, und der zum anderen - meinem Eindruck nach - eine der maßgeblichen Stimmen unserer Generation ist. Desweiteren versteht Herr Leitner Ulrike Sandig und Daniela Seel nicht. Und schlägt implizit vor, solchen DichterInnen keine Preise mehr zu verleihen. Das alles, wie gesagt, unter Berufung auf die Literaturszene.
Ich sage es deutlich: auf mich darf Leitner sich nicht beziehen, ich stimme ihm nicht zu, in keinem Punkt (ausser in eben dem einen, dass die Jurys in Deutschland ihre Preise immer in die gleiche Richtung werfen). Und ich will unter keinen Umständen, so wie von Leitner vorgeschlagen, dass Lyrikpreise an Herausgeber, Lyrikvermittler und Lyrikveranstalter vergeben werden.
Dann schon lieber alle, alle an Nora Gomringer.
Zur Preisverleihung an Nora Gomringer: Link
Zu (u.a.) Anton G. Leitners Einlassungen: Link
Diskussion zur Preisverleihung: Link
Diskussion zur Leitners Einlassungen Link
Das Gedicht "Und es war ein Tag", gelesen von der Autorin: Link
.
Donnerstag, 19. April 2012
(Nachtrag vom 22. April 2012 zum 18. April 2012).
Und alle, alle waren sie da. Man kann sagen, die Massen strömten zu Max Premiere. Kaum ist sein erstes Buch auf dem Markt, schon liest er in der Literaturwerkstatt, und nahezu hundert Zuhörer kommen. Es war kein Sitzplatz mehr zu bekommen, das Publikum stand bis in den Vorraum. Und zu Recht, denn Max ist ein großes Talent - ich weiß, das hört sich ein bisschen herablassend an, wenn ich es hier so daher schreibe, aber es ist mir ein wirkliches Bedürfnis zu sagen: Max Czollek ist ein großes Talent. (Und zu meiner Freude im selben Verlag wie ich). Allein sein Gedichtzyklus über jiddische Dichter hat das Zeug zu einem Klassiker. Doch auch die anderen Texte des Bandes gewinnen bei jedem Wiederhören, und einige habe ich mittlerweile ein Dutzend Mal vorgelesen bekommen.
Nach der Premiere die übliche Sause, nur an diesem Abend viel größer, rauschhafter, ausgelassener. Johannes ließ die Wodkagläser tanzen, Dominik die Whiskey-Tumbler. Schließlich war ich so betrunken, dass ich kaum noch den Auslöser meiner Kamera fand. (Und diese zehn Jahre alte Digital-Knipse ist eine ausgemachte Katastrophe, sie löst meist erst mit vier, fünf Sekunden Zeitverzögerung aus. Ein Wunder, das ich überhaupt halbwegs brauchbare Photos zustande bekommen habe. Wobei: 90 % waren ein Konglomerat aus Schlieren. Ich brauche schnell eine neue - aber woher will man die nehmen als armer Poet?)
.
Und alle, alle waren sie da. Man kann sagen, die Massen strömten zu Max Premiere. Kaum ist sein erstes Buch auf dem Markt, schon liest er in der Literaturwerkstatt, und nahezu hundert Zuhörer kommen. Es war kein Sitzplatz mehr zu bekommen, das Publikum stand bis in den Vorraum. Und zu Recht, denn Max ist ein großes Talent - ich weiß, das hört sich ein bisschen herablassend an, wenn ich es hier so daher schreibe, aber es ist mir ein wirkliches Bedürfnis zu sagen: Max Czollek ist ein großes Talent. (Und zu meiner Freude im selben Verlag wie ich). Allein sein Gedichtzyklus über jiddische Dichter hat das Zeug zu einem Klassiker. Doch auch die anderen Texte des Bandes gewinnen bei jedem Wiederhören, und einige habe ich mittlerweile ein Dutzend Mal vorgelesen bekommen.
Nach der Premiere die übliche Sause, nur an diesem Abend viel größer, rauschhafter, ausgelassener. Johannes ließ die Wodkagläser tanzen, Dominik die Whiskey-Tumbler. Schließlich war ich so betrunken, dass ich kaum noch den Auslöser meiner Kamera fand. (Und diese zehn Jahre alte Digital-Knipse ist eine ausgemachte Katastrophe, sie löst meist erst mit vier, fünf Sekunden Zeitverzögerung aus. Ein Wunder, das ich überhaupt halbwegs brauchbare Photos zustande bekommen habe. Wobei: 90 % waren ein Konglomerat aus Schlieren. Ich brauche schnell eine neue - aber woher will man die nehmen als armer Poet?)
 |
| Johannes Frank, Ricardo Domeneck |
 |
| Tom Schulz |
 |
| Jan Skudlarek |
 |
| Max Czollek |
 |
| Jan Kuhlbrodt |
 |
| Im Publikum: ? |
 |
| Max Czollek |
 |
| Jan Kuhlbrodt, Max Czollek |
 |
| Publikum |
 |
| Im Hintergrund: Tom Schulz, Eberhard Häfner |
 |
| Rausch |
 |
| Norbert Lange, Jan Kuhlbrodt |
.
Montag, 16. April 2012
Schon meine gesamte Kindheit habe ich mit Malen verbracht, jeden Tag saß ich über Papier gebeugt, im Kindergarten, in der Schule, zu Hause.
Einmal, als ich eine Maske für Fasching malte, beugte sich meine Kindergärtnerin dazu und fragte, woher ich denn den silbernen Stift hätte, mit dem ich diese große Maske ausgemalt hatte. Es war ein Bleistift, ich hatte stundenlang daran gearbeitet.
Jahre später, 1979, beim Umzug von Lüneburg nach Karlsruhe, gingen alle Zeichnungen verloren, mehr als zweitausend Stück. Mein Frühwerk - vermutlich auf der städtischen Müllkippe.
Eines der wenigen Dinge, die die Zeiten überlebte, war ein Ausmalbuch mit Geschichten aus dem Alten Testament. Vermutlich weil es beim Umzug in einer Bücherkiste gelandet war. Ich mag noch heute die wilde, psychedelische Farbgebung.
Der Rest also auf der Müllkippe; das dämpfte meinen Ehrgeiz und meinen Fleiß für einige Jahre, bis ich dann mit Fünfzehn wieder anfing, nachdem ich in der ART einige Bilder von Helmut Middendorf und Rainer Fetting gesehen hatte. Farbrausch.
In den 90ern lebte ich als Maler in Friedrichshain und Kreuzberg, hatte die eine oder andere Ausstellung, und steckte mit dem Schreiben zurück. Meine Wohnung war mein Atelier und roch nach Terpentin, Leinöl und Knochenschwarz (ein Geruch wie aus der Gruft). Dazu Nikotin und abgestandener Rotwein (die Flasche für 1 Mark 99).
Ich wurde besser, aber ich wurde niemals wirklich gut. Ich stieß gegen Wände, ich war nicht so gut, wie ich sein wollte, also hängte ich die Palette an den Nagel, kurz nach der Jahrtausendwende. Die letzten Sachen waren abstrakte Aquarelle (die einzigen eigenen Arbeiten, die noch heute im Flur hängen).
Vorbei das Leben der Boheme, keine trocknenden Bilder an den Wänden, keine Farbspritzer und ausgedrückten Zigarettenkippen auf dem Dielenboden, nur noch Schriftsteller.
Nur noch Schriftsteller, aber was für einer. Nachdem ich das Malen aufgegeben hatte, ging das Leben als Künstler erst richtig los: sechzig, siebzig Gedichte im Jahr, Theaterstücke, Romane. Endlich keine Wände mehr.
Heutzutage befriedige ich meine Sehnsucht nach bildnerischer Arbeit mit merkwürdigen Computergrafiken und Skulpturen aus LEGO.
.
Einmal, als ich eine Maske für Fasching malte, beugte sich meine Kindergärtnerin dazu und fragte, woher ich denn den silbernen Stift hätte, mit dem ich diese große Maske ausgemalt hatte. Es war ein Bleistift, ich hatte stundenlang daran gearbeitet.
Jahre später, 1979, beim Umzug von Lüneburg nach Karlsruhe, gingen alle Zeichnungen verloren, mehr als zweitausend Stück. Mein Frühwerk - vermutlich auf der städtischen Müllkippe.
Eines der wenigen Dinge, die die Zeiten überlebte, war ein Ausmalbuch mit Geschichten aus dem Alten Testament. Vermutlich weil es beim Umzug in einer Bücherkiste gelandet war. Ich mag noch heute die wilde, psychedelische Farbgebung.
 |
| Florian Voß, Joseph - Sohn des Jakob, um 1975 |
Der Rest also auf der Müllkippe; das dämpfte meinen Ehrgeiz und meinen Fleiß für einige Jahre, bis ich dann mit Fünfzehn wieder anfing, nachdem ich in der ART einige Bilder von Helmut Middendorf und Rainer Fetting gesehen hatte. Farbrausch.
In den 90ern lebte ich als Maler in Friedrichshain und Kreuzberg, hatte die eine oder andere Ausstellung, und steckte mit dem Schreiben zurück. Meine Wohnung war mein Atelier und roch nach Terpentin, Leinöl und Knochenschwarz (ein Geruch wie aus der Gruft). Dazu Nikotin und abgestandener Rotwein (die Flasche für 1 Mark 99).
Ich wurde besser, aber ich wurde niemals wirklich gut. Ich stieß gegen Wände, ich war nicht so gut, wie ich sein wollte, also hängte ich die Palette an den Nagel, kurz nach der Jahrtausendwende. Die letzten Sachen waren abstrakte Aquarelle (die einzigen eigenen Arbeiten, die noch heute im Flur hängen).
 |
| Florian Voß, OT, um 2001 |
Vorbei das Leben der Boheme, keine trocknenden Bilder an den Wänden, keine Farbspritzer und ausgedrückten Zigarettenkippen auf dem Dielenboden, nur noch Schriftsteller.
Nur noch Schriftsteller, aber was für einer. Nachdem ich das Malen aufgegeben hatte, ging das Leben als Künstler erst richtig los: sechzig, siebzig Gedichte im Jahr, Theaterstücke, Romane. Endlich keine Wände mehr.
Heutzutage befriedige ich meine Sehnsucht nach bildnerischer Arbeit mit merkwürdigen Computergrafiken und Skulpturen aus LEGO.
 |
| Florian Voß, LEGO Totenschädel, LEGO Totenkopf, 2012 |
.
Samstag, 14. April 2012
Gestern Abend eine sehr rauschhafte Lesungsperformance von Jinn. Die Premiere ihres Debüts, das unlängst im Verlagshaus J. Frank erschienen ist. Dass sie interessante Texte schreibt, wusste ich ja schon. Aber die Performance war wirklich - insbesondere wenn man die beschränkten technischen Möglichkeiten bedenkt - ideenreich und tiefgründig. Schamanistisches Bemalen der Bücher mit einem Federstock, Bewispern der Gedichte. Filme, Photos, Tonbandeinspielungen. Und die Gespenster in den technischen Geräten, im Laptop, im Smartphone - dahin haben sie sich zurück gezogen.
Und ich habe mir nach der Lesung einen der bezauberten Bände gesichert. Goldene Strichgesten auf dem Titel.
Die Veranstaltung in der ACUD-Galerie war sehr gut besucht, sicher 50 bis 60 Zuhörer, viele Kollegen darunter. Nach der Lesung stundenlanges Trinken und Reden. Als schließlich alle gegangen waren, saß ich noch lange mit Björn dort, über den letzten Wein gebeugt. (Heute dementsprechend schweren Kopf. Dünnhäutiges Subjekt, dass sich versucht die Pergamenthülle über dem Nervenbast zusammen zu zurren).
.
Und ich habe mir nach der Lesung einen der bezauberten Bände gesichert. Goldene Strichgesten auf dem Titel.
Die Veranstaltung in der ACUD-Galerie war sehr gut besucht, sicher 50 bis 60 Zuhörer, viele Kollegen darunter. Nach der Lesung stundenlanges Trinken und Reden. Als schließlich alle gegangen waren, saß ich noch lange mit Björn dort, über den letzten Wein gebeugt. (Heute dementsprechend schweren Kopf. Dünnhäutiges Subjekt, dass sich versucht die Pergamenthülle über dem Nervenbast zusammen zu zurren).
 |
| Synke Köhler |
 |
| Mikael Vogel |
 |
| Jinn Pogy liest |
 |
| Jinn Pogy bemalt Bücher |
 |
| Bemalte Bücher |
 |
| Bemalte Bücher |
 |
| Eberhard Häfner und Johannes Frank |
 |
| Eberhard Häfner und Johannes Frank |
 |
| Tom Schulz |
 |
| Tom Schulz und Björn Kuhligk |
 |
| Björn Kuhligk |
.
Freitag, 13. April 2012
Vor einigen Tagen habe ich damit begonnen Familienphotos einzuscannen. Bald werden die ersten photographierten Generationen meiner Familie im Orkus, in der Namenslosigkeit verschwunden sein. Schon bei der Generation meiner Urgroßeltern fällt es mir schwer, eine in meiner Kindheit kolportierte Anekdote aus dem Gedächtnis hervor zu kramen. Ja, mein Urgroßvater, der Maler Johannes Tielens, über den weiß ich einiges (aber viel letztendlich auch nicht, obwohl er recht bedeutend für die europäische Moderne war; es muss unter anderem noch ein Teil seines Briefwechsels mit Kurt Schwitters in dessen Nachlass sein, aber ich komme einfach nicht dazu, nachzuforschen). Der Rest dieser Familie hingegen: fremde, viktorianische Kleinbürgergesichter. Teilweise von einer unglaublichen Verkniffenheit. Ab und an ein Bonvivant mit Kreisäge. Wer waren die? Was ist von denen in mir?
Wie gestern Abend schon Thetis zu Archill sagte, dargestellt von Julie Christie und Brad Pitt in dem Film Troja: deine Kinder werden sich an dich erinnern, deine Enkel nur noch an einen alten Mann, danach wird dein Name vergessen sein, es sei denn du ziehst gegen Troja. Dann: Unsterblichkeit. (Und mir kommt mein neuer Roman wie Troja vor).
Auch die Photographien der 70er Jahre sehen für mich schon ausgesprochen historisch aus. Wie verblasst die Farben, wie Fremd dieses Kind, das ich war. Wenn auch nett anzuschauen, könnte der Bruder meines Sohnes sein. - Und wie karg die Inneneinrichtungen, fast ärmlich. Wie fett die Welt geworden ist seitdem.
Tristan wird sich noch an meine Person erinnern, wenn er alt ist, und seine Kinder vielleicht. Dann ist meine Person verschwunden, voll und ganz. Übrig werden nur die Bücher dieser Person bleiben (wenn es gut läuft; in allen meinen Träumen sehe ich Flohmarktkisten im Jahre 2065: Kennst du den? Nie gehört, lass lieber liegen, der Band müffelt zu sehr nach Keller!). Nur die Berichte in den Büchern, aber kein Fleisch, kein Blut, kein Geruch.
Und selbst die Photographien werden irgendwann fehlgedeutet, können nicht mehr zugeordnet werden. In den Müll damit, oder (wenn es gut läuft) auf den Speicher.
Jahrzehnte später versuchen die Germanisten die Gesichter zuzuordnen: ist das der Voß? Nein, das kann nicht sein. Zur Baumblüte in Werder 2005 war er doch nachweislich in Spanien. Wir haben da sicher datierte Bilder im DLA. Aber wer ist es dann? Die Person ähnelt ihm sehr. Ein Doppelgänger?
Vor einigen Jahren wurde eine Photographie aus der Zeit um 1885 gefunden, vermutlich in Aden aufgenommen. Ein Mann auf dem Photo könnte Arthur Rimbaud sein. Es wäre das einzige Bild, das ihn (mit erkennbaren Gesichtszügen) im erwachsenen Alter zeigt, einige Jahre vor seinem Tod.
Sieht so ein Dichter aus? Nein, so sieht ein Waffenhändler aus. Ein etwas verschlagener, etwas stumpfer Abenteurer. So sah er aus: Rimbaud. Glaube ich.
(Rimbauds größte Werke / waren seine Gewehre / Ich habe sie alle gelesen / und starre jede Nacht hinein)
.
 |
| Johannes Tielens um 1950 |
Wie gestern Abend schon Thetis zu Archill sagte, dargestellt von Julie Christie und Brad Pitt in dem Film Troja: deine Kinder werden sich an dich erinnern, deine Enkel nur noch an einen alten Mann, danach wird dein Name vergessen sein, es sei denn du ziehst gegen Troja. Dann: Unsterblichkeit. (Und mir kommt mein neuer Roman wie Troja vor).
Auch die Photographien der 70er Jahre sehen für mich schon ausgesprochen historisch aus. Wie verblasst die Farben, wie Fremd dieses Kind, das ich war. Wenn auch nett anzuschauen, könnte der Bruder meines Sohnes sein. - Und wie karg die Inneneinrichtungen, fast ärmlich. Wie fett die Welt geworden ist seitdem.
 |
| Die gemäßigte Hippiefamilie von Florian Voß |
Tristan wird sich noch an meine Person erinnern, wenn er alt ist, und seine Kinder vielleicht. Dann ist meine Person verschwunden, voll und ganz. Übrig werden nur die Bücher dieser Person bleiben (wenn es gut läuft; in allen meinen Träumen sehe ich Flohmarktkisten im Jahre 2065: Kennst du den? Nie gehört, lass lieber liegen, der Band müffelt zu sehr nach Keller!). Nur die Berichte in den Büchern, aber kein Fleisch, kein Blut, kein Geruch.
Und selbst die Photographien werden irgendwann fehlgedeutet, können nicht mehr zugeordnet werden. In den Müll damit, oder (wenn es gut läuft) auf den Speicher.
Jahrzehnte später versuchen die Germanisten die Gesichter zuzuordnen: ist das der Voß? Nein, das kann nicht sein. Zur Baumblüte in Werder 2005 war er doch nachweislich in Spanien. Wir haben da sicher datierte Bilder im DLA. Aber wer ist es dann? Die Person ähnelt ihm sehr. Ein Doppelgänger?
Vor einigen Jahren wurde eine Photographie aus der Zeit um 1885 gefunden, vermutlich in Aden aufgenommen. Ein Mann auf dem Photo könnte Arthur Rimbaud sein. Es wäre das einzige Bild, das ihn (mit erkennbaren Gesichtszügen) im erwachsenen Alter zeigt, einige Jahre vor seinem Tod.
 |
| Arthur Rimbaud um 1885 in Aden |
Sieht so ein Dichter aus? Nein, so sieht ein Waffenhändler aus. Ein etwas verschlagener, etwas stumpfer Abenteurer. So sah er aus: Rimbaud. Glaube ich.
(Rimbauds größte Werke / waren seine Gewehre / Ich habe sie alle gelesen / und starre jede Nacht hinein)
.
Dienstag, 10. April 2012
Vor Müdigkeit bekomme ich kaum noch klare Strukturen in meine Gedanken. Ich habe zu wenig geschlafen, die letzten Jahre (die letzten Jahrzehnte, letzten Jahrhunderte? Call me the Highlander), und ich nähere mich langsam einem durchschnittlichen IQ.
NICO im CD-Player, Marble Index & Desertshore. Das war die heroische Musik meiner Jugend; ich habe nie verstanden, wie man das deprimierend finden konnte. So eine das Gesicht umschmeichelnde Kühle. Ganz aus der Zeit gefallen, nie einer Zeit angehörend, ein Amalgam von erdachtem, licht- und wolkendurchfluteten Mittelalter und von träger Schwärze eines mutterleibwarmen Apartments an der Lower Eastside. Musik für Dichter.
Als ich damals des späten Nachmittags durch den Schlossgarten der Residenzstadt Karlsruhe strolchte; krähenverhangener Himmel über einem spätbarocken, zweiflügeligen Bau mit einem zurück gesetzten Turm. All das in Weiß und Gelb. Davor ein Französischer Garten: gut geharkt, fein beschnitten, buchsbaumgesäumt; mit etwas grobschlächtigen Göttern aus Kalkstein. Üblicherweise wurden diese Parks von den nach moderne gierenden Provinzfürsten im 19ten Jahrhundert mit Englischen Gärten überbaut. Nicht so hier, hier war der Englische Landschaftspark im rückwärtigen Theil des Schlosses angelegt worden.
Ein Spaziergang durch die Moden des Absolutismus, ein Spaziergang mit verkatertem Kopp. In schwarzem Anzug vom Pfennigbasar, mit Schnabelschuhen aus den 60ern und Ray-Ban-Sonnenbrille (später reichte es dann nur noch für die Imitate von Roy-Bom).
Wieso nur sind die zeitgenössischen Parks so hässlich, so architektonisch gedacht, niemals als Bühne für den Lustwandel angelegt? – Ich war heute mit meinem Sohn im neuen Grünstreifengelände am Gleisdreieck, Spielplätze erkunden. Alles wie mit dem Lineal gezogen, aber ohne Komposition, wie die Französischen Gärten des 18ten Jahrhunderts, sondern vielmehr wie ein missglücktes Planspiel hingeklatscht, ein Aufmarschraum für Planquadrate, nein für Planfragmente. Und keine Blumen, und keine Bäume. Nur Gestrüpp. Wie soll man da ins Denken kommen?
Von den Neubauten rund herum wollen wir gar nicht sprechen. Die schlimmste Architektur entstand ja in den Post-Wende-Jahrzehnten. Feuchte Träume fetter Technokraten. In den Innenstädten trotzdem (verbüffenderweise) in erträglichem, weil ignorierbaren, Maß, aber in der Periferie: geduckte Produktionshallen aus Blech und Normfensterfronten, verspielte Nichtigkeiten mit Kunststoffbogen und Stahlrohrgiebelchen, Zweckbauten ohne jeden Zweck.
Man sollte den heutigen Baumeistern bei Strafe verbieten sich als Künstler zu fühlen. Die sollen ihre Reißbretter, Winkel und Zirkel nehmen und Handwerk machen. Denn Künstler werden sie doch nie, nur Kunsthandwerker, wenn es sehr gut gelaufen ist. Das jetzige Übel begann in Deutschland mit Oswald Mathias Ungers – dagegen sind die Mietskasernen der 20er Jahre wahre Prachtbauten, Augenweiden.
Schon als Punk waren mir Altbauten lieber, je älter, je besser. Gotik, Barock, Klassizismus. Auch Biedermeier, Jugendstil und Neue Sachlichkeit.
Dabei schrieb ich doch (mit hochgestellten, grünen Haaren, Lederjacke und Domestosjeans) von Glas, Stahl, Neon und Beton. Aber da drinnen wohnen? Lieber war ich ein bildungsbürgerlicher Outlaw. Und entwickelte mich später auch eher zu einer Art von Neo-Existenzialisten. Und hatte Bands in denen ich sang. That´s the man with the feedback brain, every night he´s driving insane…
Ich müsste mal die Kiste mit BASF-Cassetten digitalisieren. Bald werden die Magnetbänder so verzerrt und halb gelöscht wie mein Gehirn sein. Vom Schlaf der Zeit in magnetischen Gleichklang gebracht sein. Alle Magnetpartikel auf den Bändern werden in eine Richtung weisen: in das Rauschen hinein.
Und das waren tolle Bands. Die erste hieß Electric Messias. Ich war Sechzehn, die anderen Anfang zwanzig, und wir kifften im Proberaum mehr, als das wir Songs schrieben, vielmehr improvisierten. Und traten niemals auf, was man Schade nennen könnte, denn wir waren eine der ersten Neopsychodelic-Gruppen im Süddeutschen Raum. Wir hätten die Jugend begeistert.
Wenn wir zugedröhnt waren, schienen dreißig Minuten für einen Song fast zu wenig zu sein. Und der Gitarrist hatte ein Wah-Wah-Pedal. Und der Organist eine Schweine-Orgel. Und der Bassist eine schneeweiße Ibanez. Nur der Schlagzeuger trank höchstens zwei Bier, rauchte nicht (weder Zigaretten noch Joints), hielt deshalb aber immer den Takt. Wir wären ohne ihn aufgeschmissen, wir wären hilflos gewesen. Frank Ziemann, Edgar Franke, Dirk Lakomy und ich. An den Namen des nüchternen Drummers erinnere ich mich nicht.
 |
| Florian Voß, in der Zeit der ersten Band |
Die zweite Band schaffte es sogar auf eine Platte, einen Sampler des Titels „Karlsunruhe“. Florian Haller (Gitarre), Gerald Pöhls (Bass) und ich hatten monatelang in einem winzigen Proberaum in der Amalienstraße den Song geprobt, den wir aufnehmen wollten, ihn geschliffen und poliert. Dann kam der große Tag für The Liquid Dream; zusammen mit einem Gastschlagzeuger, einem Profi aus dem Freundeskreis (Tobias Wenz von Bazooka Cain), wankten wir übernächtigt in die semiprofessionelle Tonstudio-Klitsche am Rande der Stadt und nahmen den Song (Feedback brian) in endlosen viereinhalb Stunden auf. Und weil wir noch eine halbe Stunde Studiozeit übrig hatten, hackten wir einen nicht ernst gemeinten Punkschlager in die Mikros (Nirgendwo Hirn).
Irgendeine andere Band, die auf dem Sampler erscheinen sollte, war dann wohl neidisch auf uns geworden, und hatte dem Master einen Magnetschaden verpasst, so dass der großartige Song, unser Juwel, unbrauchbar geworden war. Stattdessen landete der Punkschlager ungefragt auf dem Vinyl, zudem in Grund und Boden gemixt.
Aber alles hat ein gutes Ende: Jahre später ging der Bassist auf eine Party, und dort wurde spät Nachts ein Mixtape eingelegt. Darauf auch Nirgendwo Hirn.
Und es kam noch besser: ein besoffener Teenager-Punk lehnte sich zu unserem Bassisten und nuschelte, dass das seit langer Zeit schon sein absolutes Lieblingslied sei.
(Übervolle Aschenbecher, und mein Kopf ist Glut / Abgefucktes Brausehirn, scharfe Küchenmesser / Ich stürz ab, und das ist gar nicht gut / doch was anderes ist auch nicht besser // Ich hab nirgendwo Hirn / ich geh nirgendwo hin / Ich hab nirgendwo Hirn / es hat nirgendwo Sinn // Zeitlose Jahre, die gab es vor Jahren / Das Gedächtnis ist gewaschen und strahlend weiß / es gibt nichts zu tun, man hat nichts zu sagen / Und so hetzt man durch den Tageskreis // Ich hab nirgendwo Hirn / ich geh nirgendwo hin / Ich hab nirgendwo Hirn / es hat nirgendwo Sinn)
Geschrieben 1988, soeben auswendig aus meinem Schädel gepult und eingetippt. Meine erste und einzige Plattenveröffentlichung. Gab es sogar mal bei Amazon, gar nicht teuer, vielmehr so billig wie auch mein Roman dort. Schleuderpreise, Schleudertrauma, Lebensverlust. Aber ich stehe und singe. Und werde auf Mallorca niemals Fahrrad fahren.
.
Sonntag, 8. April 2012
Wie wenig sich geändert hat, in den letzten vierzig Jahren. Wir fahren noch immer in Benzinkutschen, wohnen in Altbauwohnungen, tragen Jeans und Jackett. Wenn ich nochmal in die SciFi-Romane der späten 70er hinein blättere: was für große Erwartungen. Marsmissionen, mondgroße, geostationäre Raumstationen (schon in den 50er Jahren von Wernher von Braun entworfen, vermutlich als eine Art kosmisches Neuschwabenland), Kernfusion.
Stattdessen ist nicht viel passiert. Die Computer sind kleiner geworden, ohne Zweifel, aber es ist die selbe Technik (vielleicht auch nur die gleiche). Mobilfunkgeräte sind ebenfalls miniaturisiert, aber Oberinspektor Derrick hatte schon 1973 ein Autotelefon (vermutlich A-Netz, vielleicht aber auch schon das hypermoderne B-Netz).
Und das Arpanet heißt seit zwanzig Jahren Internet, und ist auch außerhalb militärischer und wissenschaftlicher Kreise zugänglich. Videospiele (damals Telespiele genannt) bestehen nicht nur aus drei Pixelblöcken (PONG), aber man wird genauso stumpf in der Birne von einer halben Stunde Mario Brothers (und Super Mario existiert jetzt auch schon seit 30 Jahren).
Das Einzige, das sich stark gewandelt hat, ist die politische Lage. Systemwechsel, Sieg des Kapitals. Und die Literatur hat sich verändert, zum Besseren hin (vielleicht weil sie sich nicht mehr für das Politische zuständig fühlt). Sie ist viel komplexer geworden, tiefgründiger, weniger starr.
Aber was Umgebung und Lebensumstände anbelangt, leben wir in den anhaltenden, sich in die Jahrzehnte blähenden 70ern. (Goodbye seventies, sangen Yazoo 1982). Die gleichen Klamotten, die gleichen Kinder- und Gesellschaftsspiele, die gleichen, nein, die selben Filme (STAR WARS). Nur Barbie heißt jetzt LilliFee, und das Phantom ist in Rente gegangen (nach einem missglückten Wiederbelebungsversuch). Die anderen Superhelden allerdings: alle immer noch schwer am Machen. (Und die Masters of the Universe warten schon auf ihre Neuverwertung. Sie warten in der Weltraumstadt "Wernher von Braun II").
.
Stattdessen ist nicht viel passiert. Die Computer sind kleiner geworden, ohne Zweifel, aber es ist die selbe Technik (vielleicht auch nur die gleiche). Mobilfunkgeräte sind ebenfalls miniaturisiert, aber Oberinspektor Derrick hatte schon 1973 ein Autotelefon (vermutlich A-Netz, vielleicht aber auch schon das hypermoderne B-Netz).
Und das Arpanet heißt seit zwanzig Jahren Internet, und ist auch außerhalb militärischer und wissenschaftlicher Kreise zugänglich. Videospiele (damals Telespiele genannt) bestehen nicht nur aus drei Pixelblöcken (PONG), aber man wird genauso stumpf in der Birne von einer halben Stunde Mario Brothers (und Super Mario existiert jetzt auch schon seit 30 Jahren).
Das Einzige, das sich stark gewandelt hat, ist die politische Lage. Systemwechsel, Sieg des Kapitals. Und die Literatur hat sich verändert, zum Besseren hin (vielleicht weil sie sich nicht mehr für das Politische zuständig fühlt). Sie ist viel komplexer geworden, tiefgründiger, weniger starr.
Aber was Umgebung und Lebensumstände anbelangt, leben wir in den anhaltenden, sich in die Jahrzehnte blähenden 70ern. (Goodbye seventies, sangen Yazoo 1982). Die gleichen Klamotten, die gleichen Kinder- und Gesellschaftsspiele, die gleichen, nein, die selben Filme (STAR WARS). Nur Barbie heißt jetzt LilliFee, und das Phantom ist in Rente gegangen (nach einem missglückten Wiederbelebungsversuch). Die anderen Superhelden allerdings: alle immer noch schwer am Machen. (Und die Masters of the Universe warten schon auf ihre Neuverwertung. Sie warten in der Weltraumstadt "Wernher von Braun II").
.
Samstag, 7. April 2012
Ich höre Lieder der Troubadore aus dem frühen 13ten Jahrhundert und schaue in den Himmel. Ein paar Krähen fliegen über den Dächern und Holzrauch der Osterfeuer zieht über die Schindeln hinweg. Holzrauch über Ingelheim.
Die Familie, die Verwandten und alle Kinder sind im Garten und rösten Stockbrot, derweil ich in den grauen Himmel starre und auf eine Fernsehantenne. Sie steht unter dem Holzrauch auf dem Dach vis à vis. Diese Antennen sieht man in den letzten Jahren kaum noch, sie fielen der Digitalisierung zum Opfer, sind fast überall schon abgebaut worden. Mir waren lange keine mehr aufgefallen.
In meiner Kindheit standen Wälder dieser Antennen auf den Dächern von Lüneburg, und selbst auf dem Logo der Tagessschau waren sie als Schattenrisse zu sehen. Es ist seltsam: ich habe sie nie als hässlich empfunden, eher als Taktgeber des Firmaments.
In meinen Ohren, gespeist von einem MP3-Player, wird die Ballade eines Brüderpaars (Tormier et Palazi) abgespielt, geschrieben um 1160. Fernsehantennen der 1970er Jahre. Zukunftsaussichten: dunkel. Alles vermischt sich.
Mir ist seit Tagen schon schwindelig, und die osterliche Kälte macht mich frieren. Und im Schlaf träumte mir ein Schlaf, in dem mir etwas träumte, das ich im umfangenden Traum vergessen habe.
(Vergeblichkeit allen menschlichen Strebens).
Draußen springen die Verwandten auf dem neuen Trampolin.
(Alles gleicht sich, ist gleich gültig, gleicht sich aus).
.
Freitag, 6. April 2012
Auf der Autofahrt nach Westdeutschland, mitten in Sachsen-Anhalt (dem Land der Frühaufsteher, wie es auf einem Autobahnschild heißt), schaue ich in den Wald am Wegesrand. Ein Zehntel der Kiefern ist umgeknickt (Zahnstocher Gottes), es muss unlängst ein Sturm gewütet haben.
Kiefern, auch Fichten vermutlich, ein paar Birken: so sieht der Wald in fast ganz Deutschland aus (ehemals Land der Sümpfe und der endlosen, unzugänglichen Wälder; schon Tacitus wusste davon zu berichten, sofern seine Beschreibung von Germania keine Fälschung der Renaissance ist).
Die Natur ist nicht mehr existent in diesem Land, nur noch Fichtenschonungen, begradigte Flüsse, trocken gelegte Auen. Nur der Blick nach oben zeigt einem Natur; das Blau lässt sich nicht verwerten. Ansonsten ausgewalzte Vorstadtstrukturen, unsäglich hässliche Windräder, Industrieparks (was für ein Zynismus), Überlandleitungen.
Ich weiß, wir haben diese Klage alle schon zig Mal gelesen, aber wenn ich am zwanzigsten Mediamarkt vorbei fahre, an der hundertsten Kiefernschonung, am tausendsten McDrive, dann hab ich so Sehnsucht nach echten Wäldern, aus Eichen, Buchen und Ebereschen. Aus Lärchen, Tannen und Eiben. Mit Unterholz, Moos überwachsenen Böschungen, Hohlwegen, Lichtungen mit Auerochsen, Wölfen hinter Wildwuchs, Luchse in den Astgabeln.
Und dann mit dem gelb lackierten Postwagen nach Weimar, den Herrn Geheimrath besuchen. Schubert sitzt neben mir im Coupé und reicht mir seine Taschenflasche mit Cognac. Die Räder rattern über Stock und über Steine (aber Pferdchen brich dir nicht die Beine). Der Kutscher lässt die Zügel. Die Damen in den Damastkleidern schauen von ihren zierlichen Taschenbüchern auf und lächeln uns an. Draußen, über den Wipfeln des dunklen Tanns schwebt ein Steinadler und schreit.
Stattdessen: Mercedes A-Klasse (von 1999), Beethoven-Sonaten im Tapedeck, und draußen noch eine Kiefernschonung. Und Windräder, viele Windräder. - Die größte Verheerung der deutschen Landschaft seit dem 30jährigen Krieg, wie Botho Strauß einmal sagte. Damals in der Uckermark. Damals hinter dem Zeitgraben.
.
Auf der Autofahrt nach Westdeutschland, mitten in Sachsen-Anhalt (dem Land der Frühaufsteher, wie es auf einem Autobahnschild heißt), schaue ich in den Wald am Wegesrand. Ein Zehntel der Kiefern ist umgeknickt (Zahnstocher Gottes), es muss unlängst ein Sturm gewütet haben.
Kiefern, auch Fichten vermutlich, ein paar Birken: so sieht der Wald in fast ganz Deutschland aus (ehemals Land der Sümpfe und der endlosen, unzugänglichen Wälder; schon Tacitus wusste davon zu berichten, sofern seine Beschreibung von Germania keine Fälschung der Renaissance ist).
Die Natur ist nicht mehr existent in diesem Land, nur noch Fichtenschonungen, begradigte Flüsse, trocken gelegte Auen. Nur der Blick nach oben zeigt einem Natur; das Blau lässt sich nicht verwerten. Ansonsten ausgewalzte Vorstadtstrukturen, unsäglich hässliche Windräder, Industrieparks (was für ein Zynismus), Überlandleitungen.
Ich weiß, wir haben diese Klage alle schon zig Mal gelesen, aber wenn ich am zwanzigsten Mediamarkt vorbei fahre, an der hundertsten Kiefernschonung, am tausendsten McDrive, dann hab ich so Sehnsucht nach echten Wäldern, aus Eichen, Buchen und Ebereschen. Aus Lärchen, Tannen und Eiben. Mit Unterholz, Moos überwachsenen Böschungen, Hohlwegen, Lichtungen mit Auerochsen, Wölfen hinter Wildwuchs, Luchse in den Astgabeln.
Und dann mit dem gelb lackierten Postwagen nach Weimar, den Herrn Geheimrath besuchen. Schubert sitzt neben mir im Coupé und reicht mir seine Taschenflasche mit Cognac. Die Räder rattern über Stock und über Steine (aber Pferdchen brich dir nicht die Beine). Der Kutscher lässt die Zügel. Die Damen in den Damastkleidern schauen von ihren zierlichen Taschenbüchern auf und lächeln uns an. Draußen, über den Wipfeln des dunklen Tanns schwebt ein Steinadler und schreit.
Stattdessen: Mercedes A-Klasse (von 1999), Beethoven-Sonaten im Tapedeck, und draußen noch eine Kiefernschonung. Und Windräder, viele Windräder. - Die größte Verheerung der deutschen Landschaft seit dem 30jährigen Krieg, wie Botho Strauß einmal sagte. Damals in der Uckermark. Damals hinter dem Zeitgraben.
 |
| Photo: Malene Thyssen |
.
Donnerstag, 5. April 2012
Immerhin, es wird über ein Gedicht gesprochen. Leider über ein schlechtes. Aber wäre die Welt ein besserer Ort, würde die Welt über "Alphabet" von Inger Christensen reden? Vermutlich.
Hier, in meinen Räumen: Stille. Nur ab und an fährt draussen ein Bus vorbei, ein zu schnelles Automobil, ein zu langsamer Vogel, der gegen die einsetzende Kälte anzwitschert.
In der Küche hängt über der Speisekammertür eine Grafik von Grass. "Der Butt", geerbt von meinem Vater, bezahlt von einem Wiederholungshonorar, das er für die Rolle in einem "Tatort" bekam.
Auf dem Blatt ist die Signatur "Günter Grass" fast ebenso groß wie der Fisch. Eitelkeit, unermessliche Eitelkeit, würde ein Graphologe sagen. Aber glaube ich den Graphologen? Denn sie würden auch über meine Schrift urteilen: Eitelkeit, unermessliche Eitelkeit.
Ich habe vor Jahren ein Blatt aus dieser 100ter-Auflage bei ebay entdeckt, der Preis war knapp über 200 Euro, wenn ich mich recht entsinne. Kein großer Wert. Ein Grass. Ich hätte ihn schon längst verkauft, wäre er kein Erbstück. Und würde er mehr einbringen.
Gestern fiel mir auf, wie merkwürdig ich lese. Ich schaue durch die Buchstaben hindurch, wie man durch eine dieser 3-D-Grafiken aus den frühen 90er Jahren hindurch schauen musste, um das Bild zu erkennen. Ich sehe die Buchstaben nicht, aber ich lese sie.
Früher war das anders, da folgte ich den Zeilen mit den Augen, wenn auch nicht mit dem Finger, und ich murmelte auch nicht die Worte beim Lesen, so wie es die Mönche in den Skriptorien taten, vor der Entdeckung der Gutenberg-Galaxis.
Wann hat sich das geändert? War das schon vor Einführung des Internets so? Ich erinnere mich nicht.
Auch sehe ich keine Bilder mehr, wenn ich eine Geschichte lese, vielmehr erzählt mir eine innere Stimme, was dort auf dem Papier steht, aber die Gestalten und Kulissen bleiben schemenhaft. Ins Besondere die Gesichter der Protagonisten wollen sich einfach nicht in meinem Hirn materialisieren. Auch das war früher anders. Ich konnte geradezu herum spazieren in den Büchern von Enid Blyton. Jetzt ist alles nur Schrift und Rede. Herde der Rede...
.
Hier, in meinen Räumen: Stille. Nur ab und an fährt draussen ein Bus vorbei, ein zu schnelles Automobil, ein zu langsamer Vogel, der gegen die einsetzende Kälte anzwitschert.
In der Küche hängt über der Speisekammertür eine Grafik von Grass. "Der Butt", geerbt von meinem Vater, bezahlt von einem Wiederholungshonorar, das er für die Rolle in einem "Tatort" bekam.
Auf dem Blatt ist die Signatur "Günter Grass" fast ebenso groß wie der Fisch. Eitelkeit, unermessliche Eitelkeit, würde ein Graphologe sagen. Aber glaube ich den Graphologen? Denn sie würden auch über meine Schrift urteilen: Eitelkeit, unermessliche Eitelkeit.
Ich habe vor Jahren ein Blatt aus dieser 100ter-Auflage bei ebay entdeckt, der Preis war knapp über 200 Euro, wenn ich mich recht entsinne. Kein großer Wert. Ein Grass. Ich hätte ihn schon längst verkauft, wäre er kein Erbstück. Und würde er mehr einbringen.
Gestern fiel mir auf, wie merkwürdig ich lese. Ich schaue durch die Buchstaben hindurch, wie man durch eine dieser 3-D-Grafiken aus den frühen 90er Jahren hindurch schauen musste, um das Bild zu erkennen. Ich sehe die Buchstaben nicht, aber ich lese sie.
Früher war das anders, da folgte ich den Zeilen mit den Augen, wenn auch nicht mit dem Finger, und ich murmelte auch nicht die Worte beim Lesen, so wie es die Mönche in den Skriptorien taten, vor der Entdeckung der Gutenberg-Galaxis.
Wann hat sich das geändert? War das schon vor Einführung des Internets so? Ich erinnere mich nicht.
Auch sehe ich keine Bilder mehr, wenn ich eine Geschichte lese, vielmehr erzählt mir eine innere Stimme, was dort auf dem Papier steht, aber die Gestalten und Kulissen bleiben schemenhaft. Ins Besondere die Gesichter der Protagonisten wollen sich einfach nicht in meinem Hirn materialisieren. Auch das war früher anders. Ich konnte geradezu herum spazieren in den Büchern von Enid Blyton. Jetzt ist alles nur Schrift und Rede. Herde der Rede...
.
Abonnieren
Posts (Atom)