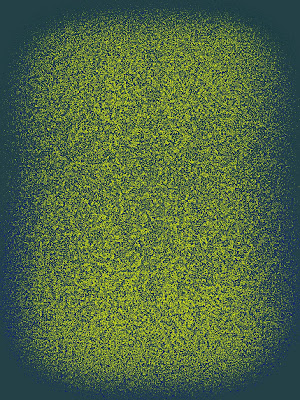Also gut, ich muss es zugeben, ich habe eine Schreibkrise.
Anstatt zumindest Gedichte zu überarbeiten, saß ich am Morgen am Wohnzimmertisch und schrieb einen Wikipedia-Artikel. Über mich.
Schon 2009 hatte irgendwer einen Eintrag über meine Wenigkeit verfasst, aber der wurde umgehend gelöscht. Auf der Diskussionsebene der Plattform hieß es, ich sei ohne ersichtliche Relevanz. Es war ein Hauen und Stechen zwischen den anwesenden Mitgliedern der Wikipedia. Doch die Fraktion, die meinte, ich sei doch durch diverse Buchveröffentlichungen ausreichend ausgezeichnet für einen Eintrag, war nicht zahlreich genug. Und dem Mann, der das gewichtigste Wort führte, war nicht beizubringen, dass die Lyrikedition 2000 kein Zuzahlverlag sei. Er bestand darauf, dass Verlage die Print on Demand betreiben per se Geld von ihren Autoren kassieren würden. Was natürlich nicht den Tatsachen entspricht. Ich versuchte ihm das zu verklickern, aber er war uneinsichtig. Ich sei nicht relevant, als Schriftsteller. Also gab ich klein bei und googelte ein paar Tage später erneut meinen Namen: kein Wikipedia-Eintrag mehr. Schade.
Heute habe ich dann aus Langeweile ein paar Änderungen in verschiedenen Artikeln anderer Dichter vorgenommen. Und weil mir so langweilig war, und weil es mich noch immer ein wenig fuchste, dass ich dort nicht vorkam, und weil mittlerweile auch für den kritischsten Administrator die Relevanzkriterien erfüllt sein sollten, bastelte ich einen Eintrag zusammen und stellte ihn online. Er steht jetzt, um 23 Uhr, noch immer dort, obwohl er schon kontrolliert wurde. Und kein Löschantrag ist verzeichnet.
Der Artikel steht also noch immer da. Und ich freue mich. Ich weiß nicht genau warum, denn ich habe ihn ja selbst geschrieben, also ist er keine besondere Auszeichnung, aber wenn ich die Seite so betrachte, fühle ich mich plötzlich wichtiger als gestern.
Wenn man als Dichter keinen großen Erfolg hat, nimmt die Jagd nach dem Ruhm seltsame Wege. Immerhin konnte ich mich letzten Monat unterstehen, auf einen Brief des deutschen
Who is Who zu antworten, in dem man mir einen Lexikon-Artikel zum Sonderpreis von 79 Euro anbot (oder war es noch teurer?).
Die einzige Frage, die mich jetzt noch umtreibt ist: soll ich eine Photographie einpflegen (und muss ich die Photographie vorher streicheln, um sie zu pflegen)? Und wenn ich das mache, soll sie in Sepia sein, oder eher mit dem verhaltenen Silberstich einer Daguerreotypie? Photoshop? Picassa? Verkubisiert von Picasso? - Ich könnte natürlich auch (mehr) Falten unter die Augen einfügen, dann brächte ich nicht gleich im nächsten Jahr den Eintrag zu aktualisieren.
Vielleicht sollte ich mir zudem eine schönere Herkunft zulegen: Sohn des Schwippschwagers des Kaisers von Äthiopien. Studierte altsteinzeitliche Kulte an der Kaldcisc-Universität in Botwarisc. Nahm an der Expedition zur Nilquelle im Jahr 1988 teil. (Seitdem teilweise verschollen). Voß gilt als einer der maßgeblichen Experten in der Bestimmung von Königsstäben der Larifari-Kultur (dazu veröffentlichte er auch das Standardwerk "Majestäten und ihre Taten im Land der Larifari", Heidelberg und Malzahn 1994).
In den Jahren 2001 und 2002 befand sich der Autor auf Astralreise zwischen Nirwana und Hohenschönhausen. Im Anschluss organisierte er das weithin besprochene Treffen
Niederer Dämonen in der Literaturwerkstatt Berlin. Dort kam es zu einem Eklat, nachdem Voß einen bekannten Dichter des Saales verwiesen hatte, weil dieser (unangekündigt) ein Gedicht über der Engel Ordnung verlesen wollte.
Voß lebt heute zusammen mit seiner Frau, seinen fünf Sohnen und diversen Murmeltieren auf einem Einödhof in der märkischen Schweiz. (Seine Korrespondenz mit Botho Strauß erscheint 2014 im Verlag der Zwei Sterne).
 |
| Subalterner Stammeshäuptling der Larifari |
Ach ja, die Änderungen in den anderen Artikeln: Ann Cotten hat jetzt eine Ausbildung als Tierkonservatorin, Hendrik Jacksons Großvater war ein Weltraumforscher und Björn Kuhligk ist in München geboren worden.
.